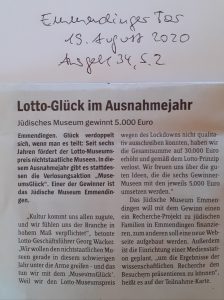Bei einem Gang über diese ehrwürdige Grabstätte mit ihren 2500 Gräbern wird Bärbel Heer in die wechselhafte Geschichte der Ortenauer Juden einführen. Der Friedhof wurde 1682 angelegt, als sich die ersten jüdischen Familien nach den Vertreibungen im Mittelalter wieder in der Region niederlassen durften. Der älteste bekannte Grabstein stammt aus dem Jahr 1701. Er trägt, wie die anderen Grabmale aus dem 18. Jahrhundert, nur hebräische Schriftzeichen. Ab 1850 wurde immer mehr die lateinische Schrift für die Grabinschriften verwendet. Interessant sind die Symbole, die manche Grabsteine tragen. Sie verweisen auf die rituellen Aufgaben, denen die Verstorbenen nachgingen aber auch über ihre Ämter im jüdischen Gemeindeleben.
Männer müssen eine Kopfbedeckung tragen, gutes Schuhwerk wird empfohlen.
Donnerstag, 27. August 2020, 18 Uhr
Treffpunkt am Parkplatz beim Friedhof an der Straße von Schmieheim nach Wallburg.
Eintritt frei, Spenden erbeten