In den Rathäusern gab es nach Kriegsende einen Bruch nur auf Leitungsebene -die Fachleute wurden für den Wiederaufbau der zerstörten Städet gebraucht. Weiterlesen: badische_z_itung_lah_24042020_Seite_6 (1)
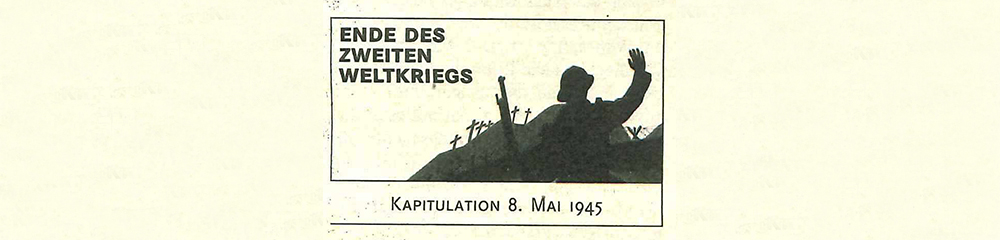

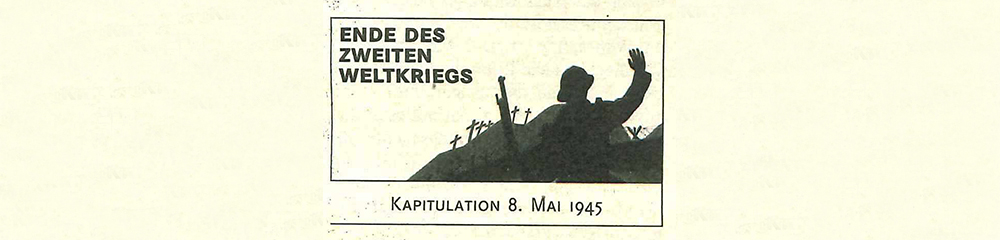
In den Rathäusern gab es nach Kriegsende einen Bruch nur auf Leitungsebene -die Fachleute wurden für den Wiederaufbau der zerstörten Städet gebraucht. Weiterlesen: badische_z_itung_lah_24042020_Seite_6 (1)

Designierter Museumsleiter Wolfgang Reinbold schildert wie die Offenburger Unternehmen zu Kriegszeiten arbeiteten – und welches Unrecht den Niedergang nicht aufhalten konnte. Weiterlesen: OT_22.4.2020_2. WK_Weberei und Spinnerei

Mehrere Tage vor der Kapitulation des Deutschen Reichs ist die Region am Oberrhein von den Franzosen eingenommen worden. Nach fast sechs Jahren des blutigsten Kriegs der Menschheitsgeschichte wurden am 21. April vor 75 Jahren die Menschen in Haslach befreit. Weiterlesen: lahrer-zeitung-23-04-2020
Weitere Erinnerungen an die NS-Verbrechen im Schwarzwald: lahrer-zeitung-23-04-2020 (1)

Ende November 1944 betraten US-Soldaten das verlassene Lager in den Vogesen, doch das Ermorden von Häftlingen fing in den zahlreichen Außenlagern weiter. Weiterlesen: badische_z_itung_lah_21042020_Seite_3
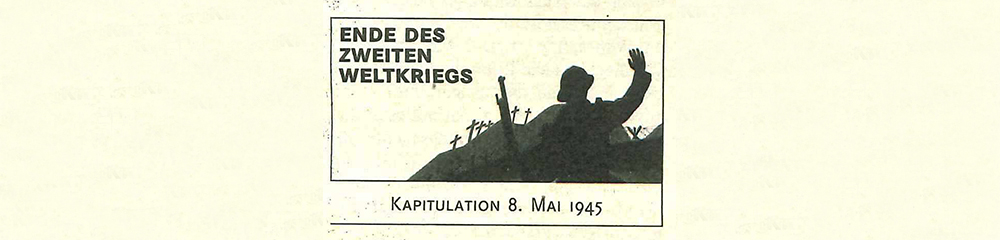
Am 21. April jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges in Breisach zum 75. Mal. Am 21. April 1945 waren französische Truppen in die Münsterstadt einmarschiert. Damit war dem Naziterror ein Ende gesetzt, doch die Bevölkerung hatte wie nach jedem Krieg weiter zu leiden, endete für die Breisacher mit dem Einmarsch französischer Truppen der Zweite Weltkrieg. Weiterlesen: badische_z_itung_fre_21042020_Seite_25

Auf Grund der Corona-Pandemie müssen Gedenkveranstaltungen zu KZ- Befreiungen auf Gäste verzichten. In mehreren Bundesländern wurde an die Befreiung von Konzentrationslagern durch die Alliierten am Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht. Weiterlesen: OT_20.4.2020_Schreckensorte der Nazi-Herrschaft
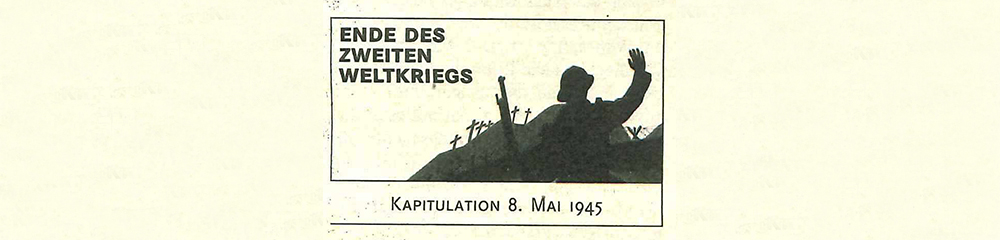
Vor 15 Jahren haben die Badische Zeitung und der SWR in einem gemeinsamen Projekt Zeitzeugen aufgerufen, zum 60. Jahrestag ihre Erlebnisse rund um das Kriegsende 1945 zu schildern. Die gebürtige Lahrerin Gertrud Neumeister (Jahrgang 1911), die bis zum Kriegsende in der Engel-Apotheke beschäftigt war, hat in ihrem Tagebuch die Zeit zwischen März 1945 und 22. April 1945 beschrieben. Die Badische Zeitung veröffentlicht in Auszügen ihre Erinnerungen aus den Tagen ab dem 19. April, nachdem die Franzosen die Stadt eingenommen hatten. Weiterlesen: badische_z_itung_lah_20042020_Seite_16

Wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben
In ihrem Buch „Geisterkinder“ erzählt Valerie von Riedesel, die Enkelin des Widerstandskämpfers Cäsar von Hofacker (1896–1944), die bewegende Geschichte ihrer Familie nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 auf Hitler. Von Hofacker, der zum Kreis der Attentäter gehörte, wurde nach fünf Monaten Gestapo-Haft hingerichtet. Seine Frau Lotte von Hofacker und die beiden älteren Kinder kamen zuerst in ein Gefängnis und dann in das Konzentrationslager Stutthof. Dort erfuhren sie vom Tod des Vaters. Als die Rote Armee näher rückte, wurden sie in das KZ- Buchenwald gebracht, wo sie mit Dietrich Bonhöffer einen Gottesdienst am 8. April 1945 feierten – einen Tag vor seiner Hinrichtung im KZ-Flossenbürg. Am 11. April 1945 besetzten die Amerikaner das KZ-Buchenwald. Lotte von Hofacker und die Kinder waren frei. Ihre Tagebuchaufzeichnungen zeugen davon, welche schlimmen Zeiten sie durchleben mussten. Valerie von Riedesel, ihre Enkelin, hat mit „Geisterkinder“ ein sehr persönliches Buch darüber geschrieben.
ursprünglich: Donnerstag 23. April 2020, 19 Uhr
Ehemalige Synagoge Kippenheim, Poststraße 17
Eintritt frei, Spenden erbeten

In der OT-Serie „75 Jahre zweiter Weltkrieg“ zeigt der Historiker und Museums-und Archivleiter Wolfgang Gall die Entwicklung Offenburgs vom völkischen Revanchismus zur liberalen Demokratie auf. Weiterlesen: OT_18.4.2020_Serie 2. WK_OG war eine Nazi-Hochburg

Im April 1945 ist die Lage im Konzentrationslager unübersichtlich. KZ-Häftlinge müssen in den Stollen des »Vulkan« ausharren und viele sterben. Der Leiter der Gedenkstätte, Sören Fuss, über die letzten Tage vor Kriegsende. Weiterlesen: lahrer-zeitung-17-04-2020 (2) oder OT_17.4.2020